Das modernste Vergleichsportal der Schweiz
Das Schweizer Vergleichsportal Checkall ist die ideale digitale Plattform für alle, die unabhängig und bequem den Vergleich wollen. Die Suche, der Vergleich und der Abschluss sind einfach, digital und unkompliziert. Von Versicherungen, Krediten, bis hin zum Auto- und Immobilienmarkt finden Sie bei Checkall alles kompakt auf einer Seite.

Dienstleistungen von Checkall
Mit unserem Vergleichsportal können Sie Krankenkassen, Autoversicherungen, Hausratversicherungen, Privathaftpflichtversicherungen und Rechtsschutzversicherungen online vergleichen. Unser Vergleichsportal ist unabhängig und neutral. Wenn Sie sich für eine Versicherung entscheiden, können Sie den Antrag online ausfüllen und sofort abschliessen. Wir übermitteln den Abschluss direkt an die Versicherungen.

Mit CheckAll zum Punkt
Es ist Schluss mit dem nervigen Suchen auf verschiedenen Internetseiten, keine lästigen Telefonate, Einholen von diversen Offerten und den langen Wartezeiten. Nur auf einer einzigen Seite finden Sie bei uns Vergleichsmöglichkeiten.
Erstaunlicher Service
Eine einfache Handhabung ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund können Sie in wenigen und sicheren Schritten einen Vergleich starten und Schritt für Schritt zu einem Vertragsabschluss gelangen. Unser kompetentes Team steht Ihnen für all Ihre Fragen zur Verfügung.

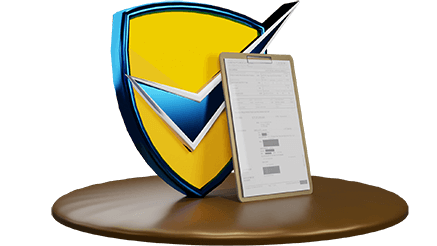
Perfekte Versicherung
Rundum versorgt: Checkall bietet Ihnen ein einzigartiges System an, auf dem Sie Online einen Vertrag abschliessen können. Die Versicherungspolice erhalten Sie innert Kürze per E-Mail oder aber auch auf Wunsch per Post.
Versicherungen vergleichen
Finden Sie mit unserem Vergleichsportal die perfekte Versicherung für Ihre Bedürfnisse. Unser spezialisierter
Krankenkassen vergleichen
Beim CheckAll-Vergleichsportal verstehen wir, wie wichtig eine zuverlässige Krankenkrankasse ist. Deshalb bieten wir Ihnen einen umfassenden
Autoversicherungen vergleichen
In unserem Vergleichsportal können Sie mühelos die
Hausratversicherungen vergleichen
Schützen Sie Ihr Zuhause und Ihre Wertgegenstände mit der passenden Hausratversicherung mit unserem Vergleichsportal. Wir helfen Ihnen, die Hausratversicherung zu finden, die optimalen Schutz gegen Risiken wie Feuer, Diebstahl und Wasserschäden bietet. Mit unserem Vergleichstool können Sie einfach und transparent Tarife und Leistungen verschiedener
Privathaftpflichtversicherungen vergleichen
In unserem Vergleichsportal können Sie
Rechtsschutzversicherungen vergleichen
Mit unserem Vergleichsportal können Sie
Finanzen
Im Bereich Finanzen können Sie in unserem Vergleichsportal auch verschiedene finanzielle Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Zu den Finanzen gehören die Möglichkeit, Kredite zu beantragen und Hypotheken für den Kauf von Immobilien zu erhalten. Checkall ermöglicht seinen Kunden die fundierte Beratung und Unterstützung in allen finanziellen Angelegenheiten zu bieten.
Kredit
Im Bereich Kredit bietet das Checkall-Vergleichsportal auch verschiedene Kreditoptionen an, um Kunden bei der Finanzierung ihrer Bedürfnisse zu unterstützen. Egal, ob es sich um einen
Hypothek
Unser Vergleichsportal bietet Hypotheken für den Kauf einer Immobilie für Sie an, die auf ihre spezifischen finanziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere erfahrenen Finanzexperten stehen bereit, um Sie bei der Auswahl der

Versicherungsgesellschaften
Das Checkall-Vergleichsportal arbeitet mit grössten Versicherungsgesellschaften in der Schweiz zusammen.
Rechner von Checkall-Vergleichsportal
Einige Rechner von Checkall-Vergleichsportal sind wie folgt:



























